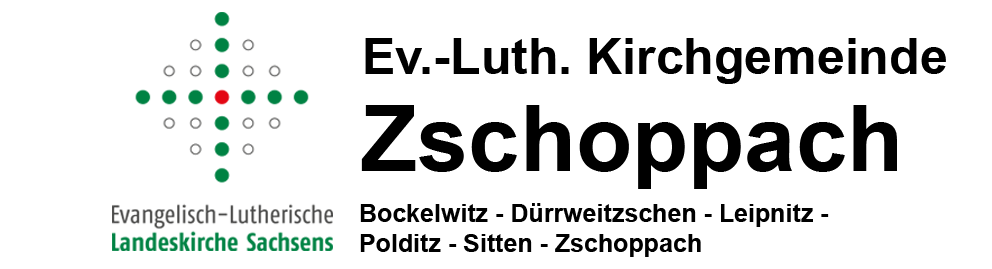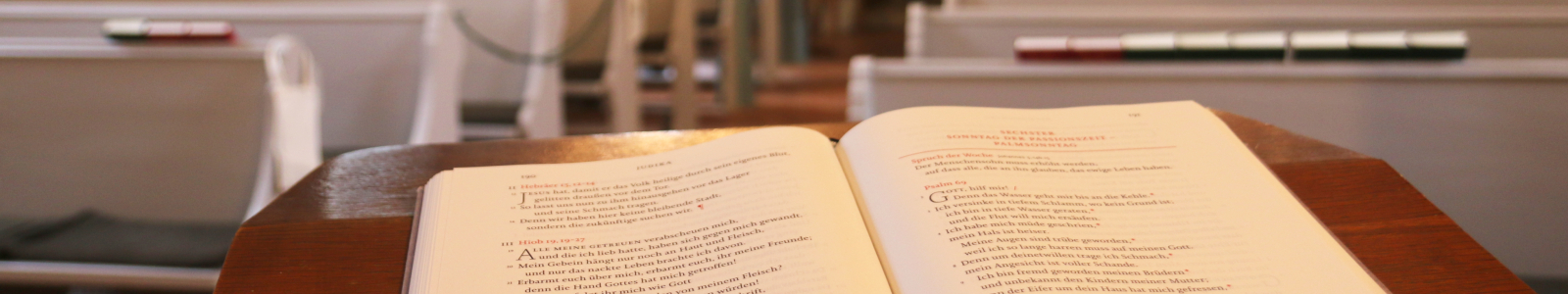Andacht
Mittendrin
Liebe Leserinnen und Leser,
die Monate Februar und März 2026, für die diese Ausgabe von „Gemeinsam unterwegs“ erscheint, sind im Kirchjahr durch die Passionszeit geprägt: Erinnerung an Jesu Leiden und Sterben. Der ziemlich kurze, nämlich nur drei Worte umfassende Monatsspruch für den März wirkt wie gemacht für einen traurigen Anlass: „Da weinte Jesus“ (Johannes 11,35). Ein unscheinbarer Satz. In seinem Kontext stehen Aussagen, denen mehr Aufmerksamkeit geschenkt und mehr Gewicht beigemessen wird. „Ich bin die Auferstehung und das Leben“ (Joh 11,25) oder „Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist“ (Joh 11,27). Was machen Jesu Tränen neben Auferstehung und Christusbekenntnis erwähnenswert? Warum war es dem Evangelisten wichtig, diese drei Worte aufzuschreiben neben einem Ich-bin-Wort, einem Christusbekenntnis und einer Totenauferweckung? Was macht Jesu Tränen zur frohen Botschaft, zum Evangelium? Bevor Jesus weint, weinen viele: Marta weint, ihre Schwester Maria weint und ihre Nachbarn und Bekannten, vom Evangelisten Johannes „die Juden“ genannt, weinen auch. Es wird geweint, weil Lazarus gestorben ist, Martas und Marias Bruder. Die Schwestern hatten Jesus ausrichten lassen, Lazarus sei krank, doch Jesus macht sich nicht sofort auf den Weg. Als er ankommt, ist Lazarus schon im Grab. Die Schwestern schwanken zwischen der Trauer über den Tod des Bruders, dem Vorwurf, Jesus hätte sich mehr beeilen sollen und der Hoffnung, er könne vielleicht doch noch etwas ausrichten. Am Grab weinen alle. Jesus ärgert sich – warum eigentlich? – und dann weint auch er. „Da weinte Jesus.“ So knapp und nüchtern übersetzt die Einheitsübersetzung. „Und Jesus gingen die Augen über.“ So poetisch steht es in der Lutherbibel. Andere Übersetzungen sprechen davon, dass Jesus die Tränen kommen. Es kommt über ihn, Jesus zeigt Emotionen, ist ganz Mensch – das ist Evangelium. Wo Tränen fließen, sind Emotionen im Spiel, seien es Tränen der Trauer oder Tränen der Freude. Das gilt selbst im Schauspiel. Theatertränen werden in der Regel erzeugt, indem Emotionen aktiviert werden. Jesus zeigt Emotionen, ist innerlich berührt von dem, was um ihn herum geschieht. Das ist nicht selbstverständlich. Jesus, das hebt Johannes noch mehr hervor, als die anderen Evangelisten, ist als Sohn, als Fleisch gewordenes Wort Gottes, jederzeit Herr der Lage. Er weiß, dass er Lazarus im Grab finden wird. Er weiß, dass er an ihm ein Wunder vollbringen wird. So wie er auch weiß, dass sein weiterer Weg ans Kreuz geht. Er weiß das alles. Nichts kann ihn überraschen. Was die Menschen um ihn herum denken, könnte ihm egal sein. Aber wo es für Menschen um Leben und Tod geht, wird er emotional. Wenn es um Menschen geht, wird Jesus leidenschaftlich. Menschen sind seine Leidenschaft, wir sind seine Passion. Wenn es um Menschen geht, ist Jesus, ist Gott nicht nur dabei, sondern mittendrin. Mittendrin im Leben mit allen Emotionen. Mit Tränen der Trauer und der Freude. Von Bethlehem über Galiläa bis nach Jerusalem. Von der Krippe bis ans Kreuz. „Da weinte Jesus.“ Gott ist Mensch geworden, ganz und gar. Auch Tränen verkündigen das Evangelium.
Herzlich grüßt Sie
Ihr Dr. Sven Petry, Sup.